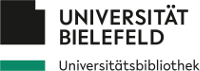Titelaufnahme
Titelaufnahme
- TitelShared decision-making : Entscheidungserleben von Patienten im Verlauf einer Krebserkrankung
- Verfasser
- Gutachter
- Erschienen
- SpracheDeutsch
- DokumenttypDissertation
- Schlagwörter
- URN
Zugriffsbeschränkung
- Das Dokument ist frei verfügbar
Links
- Social MediaShare
- Nachweis
- IIIF
Dateien
Klassifikation
Zusammenfassung
Chronische Krankheiten - wie beispielsweise Krebserkrankungen - bestimmen zunehmend das Krankheitsgeschehen in den industrialisierten Ländern. Mit ihnen wächst die Dringlichkeit zu einer konsequenten Patienten- beziehungsweise Nutzerorientierung bei der Interaktiongestaltung zwischen Patienten und Behandelnden. Dies steht im Einklang mit Demokratisierungstendenzen im Gesundheitswesen, im Zuge derer das Modell des benevolenten Paternalismus, welches durch ein hohes Maß an Asymmetrie in der Beziehung zwischen Patienten und professionellen Akteuren gekennzeichnet ist, für fragwürdig befunden wird. Abgelöst wird es von Modellen - wie beispielsweise Shared decision-making -, welche die aktive Rolle des Patienten und mehr Partizipation und Einflussnahme von Patienten an Behandlungs- und Versorgungsentscheidungen betonen. Infolge des medizinischen Fortschritts hat sich die Lebensspanne mit einer Krebserkrankung deutlich ausgedehnt. Gleichzeitig ist eine Zunahme von Therapieoptionen zu verzeichnen. Ungewissheit ist im Leben von Krebspatienten kein vorübergehender, sondern ein dauerhafter Zustand und besteht nicht nur aufgrund der Bedrohung durch die potenziell tödliche Krankheit, sondern hält auch bei günstigem, wenngleich kaum vorhersagbarem Krankheitsverlauf an. Unter dem Eindruck komplexer Belastungen müssen die Erkrankten eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Entscheidungstheoretische Erklärungsansätze wie beispielsweise Rational-Choice Theorien sind nur bedingt hilfreich bei Entscheidungen, wie sie im Verlauf einer Krebserkrankung angesichts der Lebensbedrohung und unter großer Ungewissheit getroffen werden, da sie Emotionen, Präferenzen oder konfliktbehaftete Interaktionen nicht berücksichtigen. Um diese Fragen zu beantworten bedarf es des genaueren Wissens über die Patientenwirklichkeit und darüber, wie sich solche Entscheidungsprozesse aus Sicht der Erkrankten darstellen. Zur Erfassung der Patientenperspektive bieten sich methodisch problemzentrierte, narrativ angelegte Interviews an, die den Verlaufsaspekten der Krebserkrankung besondere Beachtung schenken und auf diese Weise Präferenzen und (Entscheidungs-)Kompetenzen erfassen können. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Krebspatienten grundsätzlich an Entscheidungen, die ihre Behandlung und Versorgung betreffen, partizipieren möchten. Allerdings ist die Partizipation an Entscheidungen, wie das Modell Shared decision-making sie vorsieht, von ihnen nicht in allen Phasen ihres Krankheitsverlaufs leistbar, sondern erweist sich im Krankheitsverlauf und interindividuell als variable Größe. Zugleich deuten die Befunde an, dass eine entscheidungsfreundlichere Beziehungsgestaltung eine Kehrtwende des professionellen (Kommunikations-)Verhaltens dahingehend bedingt, dass professionelle Akteure gefordert sind, sich adhärent zu den Entscheidungsbedürfnissen der Patienten zu verhalten und nicht umgekehrt. Im Umgang mit Entscheidungen wenden die Patienten verschiedene Strategien an, um ihre Präferenzen umzusetzen und Ungewissheit zu reduzieren. Das strategische Verhalten der Erkrankten ist insbesondere dem Verhalten der professionellen Akteure geschuldet, die einen partizipativen Entscheidungsstil weder initiieren noch implizite Angebote der Erkrankten annehmen und deren Verhalten oft nicht geeignet ist, Ungewissheit der Patienten abzumildern. Die Entscheidungen der Krebspatienten sind subjektiv, interdependent sowie vor dem Hintergrund der existenziellen Bedrohung durch die Krebserkrankung in einem unsicheren und unbekannten Kontext auch von Intuitionen geprägt. Diese sowie Erfahrungen, Werte, Emotionen oder auch der Einfluss von Bezugspersonen dienen bei Entscheidungen als Filter, welche die Informationssuche steuern und die Grundlage für die Entscheidung bilden. Medizinische Evidenz spielt für die Minderung von Ungewissheit der Krebspatienten eine untergeordnete Rolle. Im Gegenteil bedingt der Zuwachs an medizinischem Wissen häufig eine Zunahme von Ungewissheit. Vielmehr ist die Beziehung beziehungsweise das Vertrauen in die Behandelnden von zentraler Bedeutung für die Entscheidungen der Krebspatienten. Entsprechend bedeutet die von ihnen gewünschte prinzipielle Wahlfreiheit nicht, unter optimaler Informationslage zu entscheiden. Im Gegenteil kann, wenn in der Beziehung zwischen Erkrankten und Behandelnden der Leitgedanke von Wahlfreiheit akzeptiert wird, Entscheidungshoheit für die Erkrankten unwichtig sein. Gerade hier eröffnet sich das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge, das auf die Problematik des normativen Charakters von Rollenbeschreibungen wie dem "mündigen" oder "kompetenten" Patienten verweist. Die prinzipiell jeder Entscheidung zugrunde liegende begrenzte Rationalität ist vor dem Hintergrund der Entscheidungen von Krebspatienten als interaktiver Prozess neu zu reflektieren. Entsprechend kann das Entscheidungshandeln der Krebspatienten nicht als rational oder irrational klassifiziert werden; vielmehr ist die Logik oder Rationalität der oft emotional stark belasteten Situation der Krebspatienten zu berücksichtigen. Es bedarf folglich eines erweiterten Rationalitätsbegriffs, der die Emotionen, Erfahrungen und Intuitionen der Patienten einbezieht.
Statistik
- Das PDF-Dokument wurde 5 mal heruntergeladen.