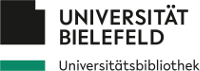Titelaufnahme
Titelaufnahme
- TitelPeer-Viktimisierung : Erfassung belastender sozialer Erfahrungen in Kindheit und Jugend und deren Auswirkungen auf Psychopathologie
- Verfasser
- Gutachter
- Erschienen
- SpracheDeutsch
- DokumenttypDissertation
- Schlagwörter
- URN
Zugriffsbeschränkung
- Das Dokument ist frei verfügbar
Links
- Social MediaShare
- NachweisKein Nachweis verfügbar
- IIIF
Dateien
Klassifikation
Zusammenfassung
Das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, Bindung und Akzeptanz stellt ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und ein überlebenswichtiges adaptives Motiv dar. Kurzfristig kann die Bedrohung der sozialen Zugehörigkeit zu Traurigkeit, Wut und Schmerzen führen, das Gefühl von Kontrolle sowie das Selbstwertgefühl verringern, während eine wiederholte oder länger andauernde Bedrohung oder Frustration des Bedürfnisses auch langfristig mit Problemen im Hinblick auf Emotionen, Kognitionen, Verhalten und die Gesundheit einhergehen kann. Kindesmisshandlung ist eine prototypische Erfahrung, bei der das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Bindung und Akzeptanz verletzt wird und die bei vielen Betroffenen mit gravierenden kurz- und langfristigen Konsequenzen einhergeht. Sie stellt einen Risikofaktor für die Entstehung von psychischen Problemen, wie z. B. unsicherer Bindung, Schwierigkeiten hinsichtlich der Emotionsregulation und schulischen Problemen sowie für psychische Störungen, dar. Kinder und Jugendliche, die von Misshandlungen im familiären Kontext betroffen sind, erleben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Viktimisierung durch Gleichaltrige. Im Gegensatz zu den Konsequenzen familiärer Misshandlungserfahrungen wurden die Auswirkungen von Peer-Viktimisierung lange unterschätzt. Studien der letzten Jahre belegen jedoch, dass Viktimisierung, Ausschluss und Ablehnung durch andere Kinder oder Jugendliche zahlreiche kurzfristige negative Folgen hat, wie Einsamkeit, ein geringes Selbstwertgefühl und posttraumatische Symptome, und auch mit langfristigen Konsequenzen wie internalisierenden und externalisierenden Problemen zusammenhängen kann.
Während der Zusammenhang von Kindesmisshandlungen und Peer-Viktimisierung mit einer psychopathologischen Entwicklung gut belegt ist, wurden die beiden Ereignistypen bisher kaum gleichzeitig untersucht, so dass nur wenig über den spezifischen Beitrag jedes einzelnen Ereignistyps hinsichtlich der Entwicklung von Psychopathologie bekannt ist. Zudem ist noch nicht ausreichend geklärt, inwiefern Peer-Viktimisierung und familiäre Misshandlungen interagieren und welchen Beitrag das Zusammenspiel der beiden Erfahrungstypen bei der Vorhersage von Psychopathologie leistet.
Wiederholte Erfahrungen von Peer-Viktimisierung können mit zahlreichen belastenden Folgen für die Betroffenen einhergehen. Bei der sozialen Phobie handelt es sich um eine psychische Störung, für die der Zusammenhang mit belastenden sozialen Erfahrungen in der Peergroup gut belegt ist. Während positive Interaktionen und eine gute Beziehung mit Gleichaltrigen die Entstehung von sozialen Ängsten bei Jugendlichen vorbeugen können, scheinen insbesondere die indirekten Formen der Peer-Viktimisierung mit subklinischen sozialen Ängsten und klinisch relevanter sozialer Phobie zusammenzuhängen. Obwohl dieser Zusammenhang gut belegt ist, sind die Mechanismen, die diesem zugrunde liegen, noch nicht ausreichend geklärt. Es wurde angenommen, dass bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der sozialen Phobie emotionale Erinnerungen in Form von assoziativen Gedächtnisnetzwerken eine Rolle spielen, wie sie auch hinsichtlich der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) postuliert werden.
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die Bedeutung von Peer-Viktimisierung im Hinblick auf die Entstehung von Psychopathologie zu untersuchen und ein besseres Verständnis für die Mechanismen, die dem Zusammenhang von Peer-Viktimisierung und sozialer Phobie zugrunde liegen, zu erlangen.
Für die Untersuchung der Fragestellungen war die Erfassung von Misshandlungserfahrungen in der Familie sowie von Viktimisierung durch Gleichaltrige erforderlich. Für die retrospektive Erhebung belastender sozialer Erfahrungen mit Gleichaltrigen lagen jedoch kaum geeignete Instrumente vor. Das Ziel der ersten Studie (MANUSKRIPT I) bestand dementsprechend darin, eine Ereignisliste zu entwickeln und zu evaluieren, mit der belastende Sozialerfahrungen in der Peergroup retrospektiv erfasst werden können. Die psychometrischen Eigenschaften des im Rahmen der Studie entwickelten "Fragebogen zu belastenden Sozialerfahrungen" (FBS) wurden an einer Stichprobe (N = 995) überprüft, die mittels einer Onlinestudie befragt wurde. Die Ergebnisse der Studie liefern erste Hinweise darauf, dass es sich bei dem FBS um ein Verfahren mit zufriedenstellender Reliabilität und Validität handelt, mit dem belastende soziale Erfahrungen mit Gleichaltrigen im deutschen Sprachraum ökonomisch erfasst werden können.
Die zweite Studie (MANUSKRIPT II) hatte zum Ziel, den Beitrag von familiärer Misshandlung, Peer-Viktimisierung und dem Zusammenspiel beider Misshandlungsformen bei der Vorhersage von Psychopathologie zu untersuchen. Für die Studie wurden drei verschiedene Stichproben untersucht: eine klinische Stichprobe (N = 168), die in psychiatrischen Krankenhäusern, Tageskliniken und einer psychotherapeutischen Ambulanz rekrutiert wurde, Erwachsene (N = 995), die die Umfrage als Onlinestudie bearbeiteten und Studierende von verschiedenen deutschen Universitäten (N = 272). Die Ergebnisse hierarchischer Regressionsanalysen zeigten ein konsistentes Muster in allen drei Stichproben: Misshandlungserfahrungen in der Familie erklärten einen signifikanten Anteil der Varianz von Psychopathologie, Peer-Viktimisierung leistete aber jeweils einen zusätzlichen signifikanten Erklärungsbeitrag über familiäre Misshandlung hinaus. Insgesamt deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass Peer-Viktimisierung einen bedeutsamen, von Kindesmisshandlung in der Familie unabhängigen, unspezifischen Risikofaktor für die Entstehung von Psychopathologie darstellt.
Die dritte Studie (MANUSKRIPT III) verfolgte die Frage, ob der Zusammenhang zwischen Peer-Viktimisierung und sozialer Phobie durch ein assoziatives Gedächtnisnetzwerk vermittelt sein könnte. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden Besonderheiten der Gedächtnisrepräsentation von belastenden sozialen Erfahrungen bei sozialphobischen (N = 39) und gesunden Personen (N = 41), die jeweils in zwei Gruppen (niedriges vs. hohes Ausmaß an Peer-Viktimisierung) eingeteilt wurden, mittels der Methode der skriptgeleiteten Vorstellung untersucht. Es wurden Skripte verwendet, die belastende soziale Erfahrungen (z. B. Zurückweisung, Ausschluss, Erniedrigung) beschreiben, welche ätiologisch bedeutsame Ereignisse im Hinblick auf die soziale Phobie darstellen könnten. Die Ergebnisse der Hautleitfähigkeit zeigten, dass die Subgruppe der Sozialphobiker mit viel Peer-Viktimisierung anhand ihrer Reaktionen von den übrigen drei Gruppen abgegrenzt werden konnte. Die Ergebnisse der Herzrate waren weniger eindeutig zu interpretieren, wiesen aber darauf hin, dass die Herzratenreaktion nicht von früheren Viktimisierungserfahrungen, sondern eher von der Diagnose einer sozialen Phobie abzuhängen schien. Die heterogenen Befunde zu den selbstberichteten Emotionen deuteten insgesamt darauf hin, dass die Intensität der Emotionen mehr von früheren belastenden Ereignissen als von der Diagnose einer sozialen Phobie abzuhängen schienen. Zusammengefasst weisen die Ergebnisse auf das Vorliegen eines assoziativen Gedächtnisnetzwerkes bei den Sozialphobikern mit Peer-Viktimisierung hin, welches eine erhöhte Vulnerabilität für die Entstehung und die Aufrechterhaltung der sozialen Phobie mit bedingen könnte.
Die Befunde der vorliegenden Arbeit gehen mit verschiedenen Implikationen einher. Zum einen erscheint es sinnvoll und notwendig, den Traumabegriff nicht ausschließlich auf Extremereignisse zu beziehen, sondern auf aversive soziale und emotionale Ereignisse auszuweiten, die bei wiederholtem Auftreten ebenfalls weitreichende negative Konsequenzen haben können. Zum anderen legen die Ergebnisse der Arbeit eine Unterteilung der sozialen Phobie hinsichtlich ihrer Ätiologie in einen Subtypen mit belastenden sozialen Erfahrungen und einen ohne belastende soziale Erfahrungen nahe. Diese Unterteilung hätte nicht nur Implikationen für die Diagnostik der sozialen Phobie sondern auch für deren Behandlung. Wenn wiederkehrende Erinnerungen an belastende soziale Erfahrungen einen zentralen Vulnerabilitäts- und Aufrechterhaltungsfaktor der sozialen Phobie darstellen, sollten diese im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung bearbeitet und modifiziert werden.
Insgesamt weisen die Ausführungen darauf hin, dass bei der Betrachtung und Behandlung psychischer Störungen eine Verschiebung der Perspektive weg von einer rein störungsspezifischen Sichtweise hin zu einer ätiologisch orientierten Perspektive lohnenswert zu sein scheint.
Statistik
- Das PDF-Dokument wurde 5 mal heruntergeladen.